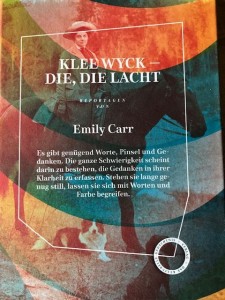 Emily Carrs “Klee Wyck – die, die lacht” beschreibt die Reste indianischer Kultur, wahrgenommen in Kanada zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und die missionarische Überheblichkeit der Siedler.
Emily Carrs “Klee Wyck – die, die lacht” beschreibt die Reste indianischer Kultur, wahrgenommen in Kanada zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und die missionarische Überheblichkeit der Siedler.
Selbst gelernte DDR-Bürger wuchsen mit Indianern auf. Mangels direkter Kontakte über Begegnungen auf Buchseiten und Leinwänden. Liselotte Welskopf-Henrichs Bücher um “Die Söhne der großen Bärin” und Joe Inya-he-Yukan und seine Queenie Tashina King oder die DEFA-Indianerfilme waren dabei trotz Reiseverbots näher an der Realität als die Karl-May-Schmonzetten. Noch sehr viel näher dran sind die Geschichten Emily Carrs.
Emily Carr (1871-1945) war eine kanadische Künstlerin. Ihr Werk als Malerin und Schriftstellerin zeigt die Vielfalt indianischer Kultur und die Folgen des Verhaltens der weißen Siedler für die First Nations, die Ureinwohner Kanadas.
“Klee Wyck” von 1941 ist ihr literarisches Debüt, das hier erstmals auf Deutsch erscheint. Der Titel bedeutet in der indianischen Sprache Chinook „die, die lacht“ – wie Carr zu diesem Namen gekommen ist, erzählt sie in der ersten der 21 Geschichten des Bandes. Der Verlag bezeichnet sie als Reportagen oder Skizzen, was es gut trifft. Den Leser erwarten keine auf Effekt gebürsteten Sensatiönchen im Magazin-Stil, sondern schlanke Miniaturen. “Komm so direkt zum Punkt wie möglich; verwende nie ein großes Wort, wenn ein kleines genügt”, so beschreibt Carr selbst ihren Schreibstil, der sich an den ihrer Malerei anlehnt.
Carr erzählt über ihre Ausflüge zu den First Nations, wo sie mit dem Kanu verlassene Dörfer ansteuert, um zu zeichnen. Über die Besuche indianischer Freundinnen bei ihr, die Körbe verkaufen und nicht auf Bezahlung drängen. Sie beschreibt indianische Friedhöfe: Die Toten sind zusammengerollt in Kisten oder Truhen bestattet, die senkrecht zwischen Bäumen stehen. Carr ist zunächst unsicher, ob sie es aushält inmitten der durch Zeit und Witterung geborstenen Kisten – „Schädel, die mich aus ihren Augenlöchern anstarrten, lugten zwischem dem Farnkraut hervor […].” Die Vegetation verbirgt die Menschen, und Carr erkennt für sich: “Es war wunderschön, wie die Meeresluft und die Sonne zu Hilfe eilten, um den Leichnamen ihren Schrecken zu nehmen.”
Die First Nations wurden durch Missionare in christliche Kultur gezwungen. Steht Carrs Kritik daran in der ersten Geschichte noch zwischen den Zeilen, wird sie später deutlicher. Etwa in “Marthas Joey”. Hier zieht eine Indianerin ein von den Eltern verlassenes Kind als eigenes Pflegekind auf. Bis Priester es ihr wegnehmen, weil das Kind weiß ist.
In einer kanadischen Neuauflage 1951 für Schulen fehlte diese Geschichte. Auch andere waren um Stellen gekürzt, die als Kritik an der Schul- und Missionarstätigkeit zu verstehen waren. Die nächste, wieder vollständige Ausgabe erschien dann erst 2003.
Ob Sie eher Gojko oder Pierre mögen (meine Frau und Gefährtin schätzt beide; Sorgen müsse ich mir aber keine machen): Bei Carr bekommen Sie einen kitschfreien Einblick in authentische indianische Kultur. Die Helden großer Taten fehlen und im Silbersee liegt kein Schatz; das Heldentum liegt hier im Überleben inmitten widriger Umstände und rassistischer Überheblichkeitskultur.
Das Buch ist im Verlag Das Kulturelle Gedächtnis erschienen, hat 176 Seiten und kostet 20 Euro.
- Interessiert an Ostdeutschland, Medien und Meinungen? Dann teilen Sie doch den Text.
 Share on Linkedin
Share on Linkedin Tweet about it
Tweet about it Print for later
Print for later Tell a friend
Tell a friend
Nach Kategorien sortieren
Letzte Artikel
- Abgeschlossenes Sammelgebiet
- Ost-Identitäten als soziales Kapital
- Der Mäzen aus dem Waisenhaus
- Weltall, Erde, Mensch
- Vom unsichtbaren Visier in den Granatenhagel
- Mohren, Missionare und Moralisten
- Der Osten und das Unbewusste
- Füllt mir eure Daten in mein Säckel
- Vertrieben, zensiert, gefördert
- Eine Jugend in Prag
- Sprachstanzen und Gedankenmuster
- Nu da machd doch eiern Drägg alleene!
- Mit dem Rolli in die Tatra-Bahn
- Der Teufel in Moskau und im Nationaltheater Weimar
- Low noise? Dreht die Regler auf!
Stimmen-Tags
Beatles-Oldie Brigadier Broiler Bückware Dummheit Ellenbogen Gemischt-Sauna größtes Glück Hartz IV Hase im Rausch Hausbuch Hilbig Honecker intolerant Kollektiv komisch Konsum Mangelwirtschaft Mauer Mokkafix Neid Oertel Patenbrigade Pflaumenmus Pionier Russen Russisch S50 Scheiße Schwarz-weiß Sex Solidarität Sport Stagnation Stasi Stern-Recorder Stimme der DDR Titten-Bilder Trabi tragisch Vita-Cola Wende weniger verkrampft Westfernsehen Wilhelm PieckLetzte Kommentare
- Redaktion bei Ost-Identitäten als soziales Kapital
- André Beck bei Ost-Identitäten als soziales Kapital
- Redaktion bei Inzest und Liebe
- Redaktion bei Colegas estrangeiros: Mosambikaner in der DDR
- Mario Kluge bei Ein Denkmal der Arbeit

